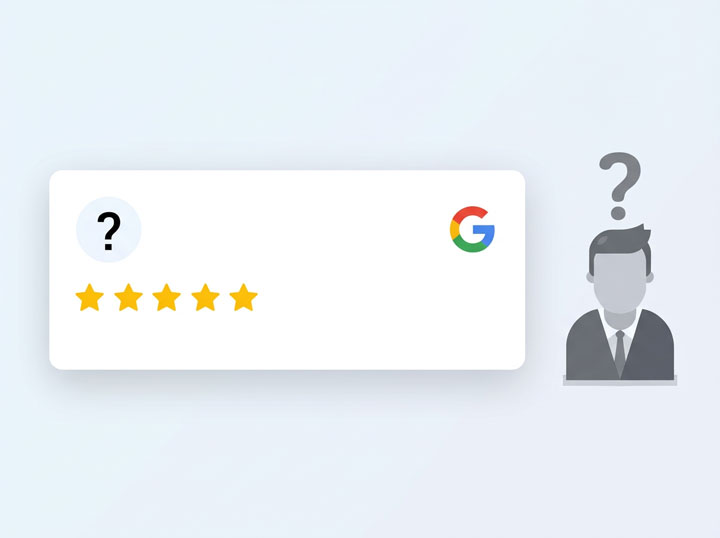Blackout in der Arztpraxis: Was tun, wenn der Strom ausfällt?

Ein Blackout, also ein überregionales und länger andauerndes Versagen der Stromversorgung, ist weit mehr als ein „etwas längerer Stromausfall“. Dabei geht es nicht um Panikmache, sondern um eine nüchterne, realistische Einschätzung eines Risikos, das in jeden professionellen Notfallplan gehört. Fällt das Netz aus, kollabieren binnen Minuten Verkehr, Kommunikation und Versorgung – ein Stresstest, der jede Arztpraxis unvorbereitet hart trifft. Wer schon heute vorausschauend plant, kann morgen die Behandlung seiner Patientinnen und Patienten auch im Dunkeln aufrechterhalten.
Blackout ist nicht gleich Stromausfall
Während ein gewöhnlicher Stromausfall meist nach kurzer Zeit lokal behoben ist, breitet sich ein Blackout wie eine Schockwelle über ganze Regionen oder Staaten aus und hält oft Stunden oder gar Tage an. Dadurch kommt es zu einem Dominoeffekt: Ampelanlagen bleiben dunkel, Tankstellen geben keinen Treibstoff mehr aus, Mobilfunknetze brechen zusammen und Wasserpumpen stellen ihren Betrieb ein. Historische Ereignisse – etwa der Blackout von New York 1977 – belegen, dass sich Kriminalität und soziale Unruhen innerhalb von Stunden potenzieren, wenn Licht, Information und Perspektive fehlen.
Wie es dazu kommen kann
Die Ursachen sind vielfältig und interagieren häufig miteinander. Das heutige Stromnetz wird in Österreich beispielsweise täglich mit vielen manuellen Eingriffen stabil gehalten – ein komplexes Geflecht, das anfällig für Störungen ist. Cyberattacken oder gezielte Sabotage mehrerer Kraftwerke können den entscheidenden Dominostein stoßen. Extreme Wetterlagen wie Hitzewellen, Hochwasser oder Sturm belasten die Infrastruktur zusätzlich; Waldbrände bringen Freileitungen zum Abschalten, und Niedrigwasser zwingt wärmeintensive Kraftwerke zur Drosselung. Hinzu kommt das Risiko, dass ein Blackout als Mittel geopolitischer Konfrontation eingesetzt wird, etwa als Antwort auf Wirtschaftssanktionen. Treffen mehrere Faktoren gleichzeitig zusammen – beispielsweise eine abendliche Verbrauchsspitze während einer Hitzewelle, wenn Klimaanlagen auf Hochtouren laufen – gerät das Netz besonders schnell aus dem Gleichgewicht.
Ein aktuelles Beispiel lieferte am 28. April 2025 die Iberische Halbinsel: Nach einer Überspannung im Netz standen Spanien und Portugal mehrere Stunden lang komplett ohne Strom da. Der offizielle Untersuchungsbericht weist die zu hohe Netzspannung als Auslöser einer Kettenreaktion aus, in deren Verlauf rund 2,2 Gigawatt Erzeugungsleistung verloren gingen und das iberische Verbundnetz kollabierte. Erst am folgenden Morgen konnte die Versorgung weitgehend stabilisiert werden – ein eindrücklicher Beleg für die Verletzlichkeit selbst hochentwickelter Stromsysteme und ein Weckruf für das Gesundheitswesen.
Hitze als Beschleuniger für Blackouts
Hitzewellen verschärfen das Blackout‑Risiko gleich doppelt: Zum einen sinkt der Wasserstand vieler Flüsse, sodass Kraftwerke nicht mehr gekühlt werden können, zum anderen steigt der Strombedarf drastisch an. Da Photovoltaikanlagen in den Abendstunden keinen Beitrag mehr leisten, entsteht eine gefährliche Lücke zwischen Angebot und Nachfrage. Der „Heat Dome“ im kanadischen Sommer 2021 hat gezeigt, wie schnell medizinische Einrichtungen an ihre Grenzen stoßen, wenn Strom und Klimatisierung gleichzeitig ausfallen und massenhaft hitzebedingte Notfälle eintreffen.
Krisenvorsorge: Konsequenzen für die Arztpraxis
Für Arztpraxen bedeutet ein Blackout einen sprunghaften Anstieg des Patientenaufkommens – Erfahrungswerte gehen von einer Steigerung auf das Zweieinhalbfache aus. Viele Menschen suchen Hilfe wegen Verletzungen, weil sie im Dunkeln gestürzt sind, andere leiden unter Angstreaktionen oder Vorerkrankungen. Besonders kritisch sind Patientinnen und Patienten, die auf elektrisch betriebene Geräte angewiesen sind, etwa Heimbeatmungen, Infusionspumpen oder Blutzuckersensoren. Gekühlte Medikamente wie Insulin verderben rasch, wenn Kühlsysteme ausfallen. Gleichzeitig reißen Lieferketten ab, weil Verkehr und digitale Bestellsysteme stillstehen; Nachschub an Einmalprodukten, Lebensmitteln oder Diesel für Generatoren ist ungewiss. Auch die häusliche Pflege gerät unter Druck: Wenn Aufzüge nicht mehr fahren und Telefone nicht klingeln, erreicht Hilfe jene nicht mehr, die am dringendsten auf sie angewiesen sind.
Vorbereitung: ein Prozess, kein Projekt
Die gute Nachricht lautet: Praxen können sich wappnen, wenn sie Vorsorge als fortlaufenden Prozess begreifen. Ein fundierter Notfallplan skizziert Zuständigkeiten, Entscheidungswege und Ablaufprotokolle. Regelmäßig geübte Blackout‑Drills zeigen dem Team, was im Ernstfall zu tun ist, und decken Schwachstellen frühzeitig auf. Mindestens ebenso wichtig ist die Eigenvorsorge der Mitarbeitenden: Wer zuhause für mehrere Tage Wasser, Nahrung, Lichtquellen und Kommunikationsmöglichkeiten bereithält, wird auch den Weg in die Praxis antreten können.
Unverzichtbar ist zudem eine zuverlässige Stromreserve. Ein Diesel‑ oder Akku‑Notstromaggregat hält essenzielle Geräte wie Sterilisator, Behandlungseinheiten und Praxisserver am Laufen; inselfähige Photovoltaik oder rückspeisefähige Elektrofahrzeuge können diese Autarkie verlängern. Digitale Patientendaten sollten täglich extern gesichert werden, und zentrale Dokumente – Kontaktlisten, Medikamentenpläne, Notfallnummern – gehören ausgedruckt in einen wasserdichten Ordner.
Die Kommunikation verdient besondere Aufmerksamkeit: Wenn Telefon und Internet ausfallen, müssen alternative Kanäle wie Funkgeräte, Satellitentelefone oder schlicht physische Aushänge greifen. Gleichzeitig zahlt sich Transparenz gegenüber den Patienten aus. Wer bereits in ruhigeren Zeiten erklärt, wie die Praxis im Ernstfall vorgeht, vermittelt Sicherheit und beugt Panik vor.
Konkrete Maßnahmen für die Arztpraxis
- Notstromversorgung sicherstellen: Dimensionieren Sie Diesel‑ oder Akku‑Generatoren nach dem tatsächlichen Leistungsbedarf (z. B. Behandlungseinheiten, Steri, Server) und führen Sie monatliche Testläufe durch. Legen Sie einen Treibstoffvorrat für mindestens 72 Stunden an.
- Wenn möglich: Energiespeicher integrieren: Prüfen Sie eine inselfähige PV‑Anlage samt Batteriespeicher oder die bidirektionale Nutzung Ihres Elektroautos (Vehicle‑to‑Home) inklusive passender Wallbox.
- Kühlkette schützen: Halten Sie medizinische Kühlboxen mit Temperatur‑Loggern bereit und hinterlegen Sie einen Trockeneis‑Notfallplan bei Ihrer Apotheke oder einem Lieferanten.
- Daten redundant sichern: Führen Sie tägliche Offline‑Backups auf externen Datenträgern durch und spiegeln Sie die Daten zusätzlich verschlüsselt in eine Cloud. Druckexemplare wichtiger Listen (Kontakte, Medikamentenpläne) gehören in einen wasserdichten Ordner.
- Krisenkommunikation aufbauen: Beschaffen Sie Funkgeräte (PMR/DMR) und ein Satellitentelefon; definieren Sie einen physischen „Schwarzes‑Brett“‑Bereich für Aushänge und Laufkarten.
- Personalplanung aktualisieren: Legen Sie Erreichbarkeitspläne, Ersatzdienst‑Pools und eine interne Bereitschaftsnummer an. Schulen Sie das Team in Heimvorsorge, damit es auch im Blackout einsatzfähig bleibt.
- Patientenscreening durchführen: Erfassen Sie geräte‑ oder kühlpflichtige Patienten, informieren Sie diese proaktiv und erstellen Sie Hand‑outs zur Eigenvorsorge.
- Vorräte anlegen: Lagern Sie medizinische Einmal‑ und Hygieneartikel für mindestens sieben Tage, Trinkwasser (14 l/Person) und haltbare Lebensmittel für das Team.
- Brandschutz und Sicherheit erhöhen: Prüfen Sie Feuerlöscher turnusmäßig, installieren Sie batteriebetriebene Rauchmelder und testen Sie portable Notfallbeleuchtung.
- Üben und dokumentieren: Führen Sie halbjährliche Blackout‑Drills durch und verankern Sie die Abläufe im Qualitätshandbuch; nach jeder Übung Lessons Learned festhalten.
Kommunikation: Schlüssel gegen Panik
Ärzte genießen hohes Vertrauen – nutzen Sie es:
- Patienten proaktiv über Blackout‑Abläufe informieren (Aushänge, Flyer, Website).
- Klare, ruhige Krisenkommunikation senkt Angst und verhindert Eskalation.
- Externe Quellen: Zivilschutzverband (Checklisten), Bundesheer‑Folder „Blackout – und dann?“, Planspiel „Neustart“.
Vorsorge in den eigenen vier Wänden
Auch den Patienten selbst lässt sich viel Stress ersparen, wenn sie elementare Tipps beherzigen und sich – wie vom Zivilschutzverband empfohlen – mit Stirnlampen, einem batteriebetriebenen Radio, Trinkwasser und Basiskost für wenigstens zwei Wochen ausstatten. Wer Medikamente kühlen muss, sollte wissen, wie lange sein Vorrat ohne Strom stabil bleibt und welche Alternativen – zum Beispiel Kühlboxen mit Eisakkus – infrage kommen. Ein Feuerlöscher gehört in Griffnähe, denn improvisiertes Kochen erhöht das Brandrisiko erheblich.
Klarheit durch Vorbereitung
Ein ausgearbeiteter Plan wirkt nicht nur organisatorisch, sondern auch psychologisch. Ohnmachtsgefühle entstehen dann, wenn Ungewissheit auf Handlungsunfähigkeit trifft. Je genauer das Praxisteam weiß, was zu tun ist, desto leichter bleibt es in Krisensituationen ruhig. Planspiele wie die Blackout‑Simulation „Neustart“ zeigen eindrucksvoll, dass Training Verantwortung in Routine verwandelt und Angst in Aufmerksamkeit.
Fazit
Ein Blackout kündigt sich nicht an, doch wer sich vorbereitet, kann seine Auswirkungen erheblich abmildern. Für die Arztpraxis bedeutet das: heute in Notstrom, Datensicherheit, Vorräte und Teamtraining investieren, morgen kühlen Kopf und Handlungsfähigkeit bewahren. Vorausschauende Vorsorge ist kein Luxus, sondern eine professionelle Pflicht – denn im Ernstfall entscheidet sie über Gesundheit und Leben der Patienten.
AKTUELLE ARTIKEL
AKTUELLE ARTIKEL
Sie suchen einen verlässlichen IT-Partner für Ihre Arztpraxis?
Wir sind it4med, ein auf Ärzte spezialisierter IT-Dienstleister. Unsere Experten unterstützen Sie bei der Planung, Umsetzung und Wartung Ihrer IT-Infrastruktur – maßgeschneidert auf die Anforderungen Ihrer Praxis. Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Kontaktieren Sie uns – wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!